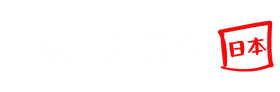Ihr Warenkorb ist leer
Daikokuten

Daikokuten (大黒天) ist eine synkretistische japanische Gottheit des Glücks und Reichtums. Daikokuten entstand aus Mahākāla, der buddhistischen Version der Hindu-Gottheit Shiva, die mit dem einheimischen Shinto-Gott Ōkuninushiverschmolzen wurde.
Übersicht
Mahākāla im ostasiatischen Buddhismus
Der Sanskrit-Begriff 'Mahākāla' ("Großer Schwarzer [Einer]", "Große Zeit" oder "Großer Tod") war ursprünglich einer der Beinamen des Hindu-Gottes Shiva in seinem Aspekt als Zeit (kāla), dem ultimativen Zerstörer aller Dinge. Dieser Titel und Aspekt Shivas wurde schließlich vom Buddhismus übernommen, wo Mahākāla als dharmapāla oder Beschützer des buddhistischen Dharma, aber auch als furchterregende Gottheit, die nachts mit Horden von Geistern und Dämonen durch die Wälder zieht, neu interpretiert wurde.
Mahākāla wird in vielen chinesischen buddhistischen Texten erwähnt, obwohl ikonographische Darstellungen von ihm in China während der Tang- und Song-Periode selten waren. Nach dem 9. Jahrhundert wurde er schließlich zum Zentrum eines blühenden Kultes in den Königreichen Nanzhao und Dali in der heutigen Provinz Yunnan, einer Grenzregion zu Tibet, wo sein Kult ebenfalls weit verbreitet war. Aufgrund des tibetischen Einflusses nahm seine Bedeutung während der mongolisch geführten Yuan-Dynastie weiter zu, und sein Abbild wurde im kaiserlichen Palast und in buddhistischen Tempeln innerhalb und außerhalb der Hauptstadt aufgestellt (obwohl die meisten dieser Bilder heute nicht mehr vorhanden sind).
Der Name der Gottheit wurde sowohl in chinesische Schriftzeichen als 摩訶迦羅 (pinyin: Móhējiāluó; Mittelchinesisch (Baxter): mwa xa kæ la) transkribiert als auch als 大黑天 (pinyin: Dàhēitiān; wörtl. 'Großer schwarzer Deva', wobei kāla als 'schwarz' verstanden wird; M. C. (Baxter): dɑH xok then). Diese wurden schließlich als Makakara (oder Makakyara) bzw. Daikokuten ins Japanische übernommen.
In einigen Texten wird Mahākāla als ein furchterregender Gott beschrieben, ein "Dämon, der die Lebensessenz (der Menschen) stiehlt" und sich von Fleisch und Blut ernährt, obwohl es auch heißt, dass er nur diejenigen verschlingt, die Sünden gegen die Drei Juwelen des Buddhismus begangen haben. Eine Geschichte, die im Kommentar des Mönchs Yi Xing aus der Tang-Zeit zum Mahāvairocana-Tantra zu finden ist, stellt Mahākāla als eine Manifestation des Buddha Vairocana dar, der die ḍākinīs, eine Rasse fleischfressender weiblicher Dämonen, unterwarf, indem er sie verschlang. Mahākāla ließ sie unter der Bedingung frei, dass sie keine Menschen mehr töteten, und verfügte, dass sie nur noch das Herz (人黄, pinyin: rénhuáng, japanisch: jin'ō) von Menschen, die dem Tod nahe waren, essen durften, da es die Lebensessenz des Menschen enthielt. Eine Erzählung in Amoghavajras Übersetzung des Humane King Sūtra berichtet, wie ein heterodoxer (d.h. nicht-buddhistischer) Meister den Prinzen Kalmāṣapāda (斑足王) anwies, Mahākāla, dem "großen schwarzen Gott des Friedhofs" (塚間摩訶迦羅大黑天神), die Köpfe von tausend Königen zu opfern, wenn er den Thron seines Königreichs besteigen wolle.
Im Laufe der Zeit wurde Mahākāla auch als Beschützer der buddhistischen Klöster, insbesondere ihrer Küchen, angesehen. Der Mönch Yijing, der im späten 7. Jahrhundert nach Srivijaya und Indien reiste, behauptete, dass in den Küchen und Vorhallen der indischen buddhistischen Klöster Bilder von Mahākāla zu finden waren, vor denen Speiseopfer dargebracht wurden:
In den großen Klöstern Indiens befindet sich an der Seite eines Pfeilers in der Küche oder vor dem Portal eine aus Holz geschnitzte Figur einer Gottheit, die zwei oder drei Fuß hoch ist, einen goldenen Beutel hält und auf einem kleinen Stuhl sitzt, wobei ein Fuß zur Erde herabhängt. Da sie immer mit Öl abgewischt wird, ist ihr Antlitz geschwärzt, und die Gottheit wird Mahākāla [莫訶哥羅, pinyin: Mòhēgēluō, M. C. (Baxter): mak xa ka la] oder die große schwarze Gottheit [大黑神, pinyin: Dàhēishén, M. C. (Baxter): dɑH xok zyin]. Die alte Überlieferung behauptet, dass er zu den Wesen (im Himmel) des großen Gottes (oder Maheśvara) gehörte.
Er liebt natürlich die Drei Juwelen und schützt die fünf Versammlungen vor Unglück. Diejenigen, die ihm Gebete darbringen, bekommen ihre Wünsche erfüllt. Zu den Mahlzeiten bringen die Küchendiener Licht und Weihrauch dar und richten alle Arten von zubereiteten Speisen vor der Gottheit an. (...) In China wurde das Bild dieser Gottheit oft in den Bezirken von Kiang-nan gefunden, jedoch nicht in Huai-poh. Diejenigen, die ihn (um einen Segen) bitten, finden ihre Wünsche erfüllt. Die Wirksamkeit dieser Gottheit ist unbestreitbar.
Yijing erzählt dann eine Anekdote darüber, wie die Gottheit einst auf wundersame Weise fünfhundert Mönche mit Nahrung versorgte, die das Kloster von Makuṭabandhana in Kushinagar besuchten, nachdem eine der weiblichen Dienerinnen vor seinem Bildnis gebetet und Opfergaben dargebracht hatte. Diese Vorstellung von Mahākāla als jemand, der den Klöstern Wohlstand brachte und Wünsche erfüllte, mag dazu beigetragen haben, dass die Gottheit in Japan als Gott des Reichtums und des Glücks gilt.
In China wurde der Gott auch mit Fruchtbarkeit und Sexualität in Verbindung gebracht: Während des Qixi-Festes (auch bekannt als. Tag des 7. Monats des chinesischen Kalenders, kauften verheiratete Frauen traditionell Puppen oder Figuren namens "Móhéluó" (魔合羅) oder "Móhóuluó" (摩睺羅) - der Begriff leitet sich wahrscheinlich von "Mahākāla" ab - in der Hoffnung, ein Kind zu gebären. Rituelle Texte schreiben die Verehrung von Mahākāla auch Frauen vor, die einen männlichen Partner suchen, oder schwangeren Frauen.
Verwandlung in Japan
Nach seiner Einführung in Japan durch die esoterischen Sekten Tendai und Shingon verwandelte sich Mahākāla (als "Daikokuten") allmählich in eine heitere, wohltätige Figur, da seine positiven Eigenschaften (z. B. als Vermittler von Reichtum und Fruchtbarkeit) zunehmend in den Vordergrund traten - meist auf Kosten seiner dunklen Züge. Während frühere Darstellungen des Daikokuten ihn als zornig (oder zumindest mit strengem Gesicht) zeigten, wurde er in späteren Kunstwerken durchweg lächelnd dargestellt.
Saichō, dem Gründer der Tendai-Schule, wird zugeschrieben, den Kult des Mahākāla-Daikokuten nach Japan gebracht zu haben. Der Legende nach erschien ihm Mahākāla bei seiner ersten Besteigung des Berges Hiei (nordöstlich von Kyoto) in Gestalt eines alten Mannes und bot ihm an, der Hüter der von Saichō geplanten Klostergemeinschaft zu werden, die später als Enryaku-ji bekannt werden sollte.
Im Mittelalter, als sich der Buddhismus und der einheimische japanische Glaube (Shinto) immer mehr vermischten, wurde Daikokuten mit dem einheimischen Kami Ōkuninushi (大国主) in Verbindung gebracht, da die ersten beiden Zeichen von dessen Namen (大国) auch als Daikoku" gelesen werden können. Daikokutens Status als Schutzherr des Enryaku-ji hat diese Verbindung ebenfalls beeinflusst: Er wurde mit Sannō Gongen, der in der Hiyoshi Taisha am östlichen Fuß des Berges Hiei verehrten Gottheit, identifiziert, die wiederum mit Ōkuninushi oder Ōmononushi (Miwa Myōjin, dem Gott des Berges Miwa in der Präfektur Nara, der auch als Ōkuninushi unter einem anderen Namen oder einem Aspekt von ihm interpretiert wird).
Der Sack oder die Tasche, die Daikokuten trägt (die bereits in Yijings Beschreibung von Darstellungen des Mahākāla in Indien bezeugt sind), diente dazu, den Gott weiter mit Ōkuninushi zu assoziieren: In der Geschichte vom Hasen von Inaba (die im Kojikizu finden ist) heißt es, dass der junge Ōkuninushi ursprünglich von seinen bösen älteren Brüdern als deren Gepäckträger behandelt worden war. Neben dem Sack erhielt Daikokuten weitere Attribute wie den goldenen Hammer namens uchide no kozuchi (wörtlich: "klopf-erscheinender kleiner Hammer", d. h. ein Hammer, der alles herausschlägt, was der Benutzer wünscht) und zwei große Reisballen. Er galt auch als Fruchtbarkeitsgott und wurde daher auch mit dem obszönen Feigenzeichen dargestellt, mit einem angedeuteten gegabelten Daikon (manchmal auch als "Braut des Daikoku" bezeichnet), mit einem riesigen erigierten Penis oder ganz und gar als hölzerner Phallus.
Mäuse und Ratten wurden ebenfalls Teil der Ikonographie des Daikokuten, was auf Mahākālas Verbindung mit Vaiśravaṇa (Bishamonten auf Japanisch), dem buddhistischen Gegenstück zum hinduistischen Kubera, und Pañcika, Vaiśravaṇas General und Gefährtin der Yakshini-Göttin Hārītī (in Japan als Kishimojin bekannt), zurückzuführen ist, die beide mit der nördlichen Himmelsrichtung in Verbindung gebracht wurden - was dem Zeichen der Ratte im chinesischen Tierkreis entspricht. (Einer der zwölf dikpālas oder Hüter der Richtungen im Buddhismus ist Īśāna, der Hüter des Nordostens, der wie Mahākāla eine buddhisierte Form von Shiva ist). Dies trug auch dazu bei, dass Daikokuten mit Ōkuninushi in einen Topf geworfen wurde, da die Mäuse auch in dessen Mythologie vorkamen.
Erfahre hier alles über die japanische Mythologie und seine Wesen.
Mittelalterliche Exegeten interpretierten Mahākāla-Daikokuten sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht: Einerseits galt er als Symbol für grundlegende Unwissenheit (ausgedrückt durch den Namen "Daikoku", der als "große Dunkelheit" interpretiert werden kann), andererseits repräsentierte er aber auch die Nondualität von Unwissenheit (symbolisiert durch das Schriftzeichen 黒, "schwarz(e) / dunkel(e)") und Erleuchtung (bezeichnet durch das Schriftzeichen 大, "groß"). Er wurde mit Ichiji Kinrin (Ekākṣaroṣṇīṣacakra, eine Manifestation sowohl des kosmischen Buddha Vairocana - genauer gesagt, Vairocanas Kopfknopf oder uṣṇīṣa - und der heiligen Silbe bhrūṃ) und somit ein Symbol der ultimativen Realität identifiziert, aber auch mit der Richtungsgottheit Īśāna (der, wie bereits erwähnt, eine weitere von Shiva abgeleitete Gottheit war), die ebenfalls als Gott der Hindernisse gilt. Aufgrund des Stigmas, das mit seiner Herkunft verbunden ist, wurde er in einigen Texten als jissha (実者, wörtlich "wahrer/wirklicher", auch bekannt als 実類, jitsurui) bezeichnet, ein "wirklicher" Gott, der als minderwertig gegenüber Gottheiten angesehen wird, die vorläufige Manifestationen von erleuchteten Buddhas und Bodhisattvas (gongen) sind. Der mittelalterliche esoterische Buddhismus ging jedoch auch von der Existenz eines "höheren" Daikokuten aus, wobei der herkömmliche Daikokuten nur eine der verschiedenen Erscheinungsformen war. Während letzteres die Unwissenheit repräsentierte, galt ersteres als Verwandlung von Unwissenheit in Erwachen.
Daikokuten wurde auch mit anderen Gottheiten wie Ugajin, Benzaiten(der buddhistischen Version von Sarasvatī), Vaiśravana-Bishamonten, dem Erdgott Kenrō Jijin (abgeleitet von der indischen Erdgöttin Pṛthivī, obwohl die Gottheit in Japan auch als männlich dargestellt wird) oder dem Weisheitskönig Acala (Fudō Myōō auf Japanisch) in Verbindung gebracht oder identifiziert. Tatsächlich wird Acala, wie Mahākāla-Daikokuten, in einigen Quellen mit dem Sieg und der Bekehrung der ḍākinīs in Verbindung gebracht und gilt auch als zorniger Avatar von Vairocana. (Auch Acala wird von einigen Gelehrten auf die eine oder andere Weise von Shiva abgeleitet).
Im Volksglauben wird Daikokuten auch häufig mit der Volksgottheit Ebisuin Verbindung gebracht. So wie Daikokuten mit Ōkuninushi in Verbindung gebracht wurde, wurde Ebisu manchmal mit Ōkuninushis Sohn Kotoshironushi oder dem Zwerggott Sukunabikona identifiziert, der Ōkuninushi bei der Erschließung des Landes Japan half. In den Häusern wurden die beiden Gottheiten in der Küche oder im Ofen verehrt, während die Kaufleute sie als Schutzgötter für den wirtschaftlichen Erfolg verehrten. Die Bauern verehrten sie als Götter des Reisfeldes (ta-no-kami).
Ikonographie
Mahākāla wurde in der ostasiatischen buddhistischen Kunst ursprünglich als dunkelhäutige, zornige Gottheit dargestellt, die ein Diadem und eine Schädelkette trägt und um deren Hals und Arme sich Schlangen winden. Ein ikonografischer Typus stellt ihn mit drei Köpfen und sechs Armen dar, wobei er mit den oberen Händen eine gehäutete Elefantenhaut, mit den unteren Händen einen Dreizack oder ein Schwert horizontal und mit den mittleren Händen eine menschliche Figur und eine Ziege hält. Viele Kunstwerke dieser Art zeigen Mahākāla in einer sitzenden Position, obwohl eine Beschreibung der Gottheit, die in dem von dem Mönch Huilin (慧琳) zusammengestellten Wörterbuch mit dem Titel Der Klang und die Bedeutung aller Sutras (chinesisch: 一切經音義, pinyin: Yīqièjīng yīnyì) zu finden ist, ihn auf den Händen der Erdgöttin stehen lässt. Im selben Werk wird Mahākāla als achtarmig beschrieben, der eine Elefantenhaut, einen Dreizack, eine Preta, eine Ziege, ein Schwert und einen khatvāṅga (eine Keule oder einen Stab mit Schädelspitze) hält. Einige in Dunhuang gefundene Darstellungen von Mahākāla dieses Typs (aus dem 9.-10. Jahrhundert) zeigen ihn inzwischen auf einer Schlange stehend.
Eine andere ikonografische Variante (die in chinesischen Texten nicht vorkommt, aber in Japan bezeugt ist) stellt Mahākāla mit einem Kopf und zwei Armen dar, wobei er in der rechten Hand ein Schwert und in der linken Hand eine Schädelschale (kapāla) hält. Manchmal wird er auch so dargestellt, dass er auf der elefantenköpfigen Gottheit Vināyaka (dem buddhistischen Gegenstück zum hinduistischen Ganesha, obwohl die buddhistische Version manchmal auch als negative Figur wahrgenommen wird) herumtrampelt, einer anderen Gottheit, mit der Mahākāla in Verbindung gebracht wird. Tatsächlich sind die beiden Gottheiten zusammen in der äußeren nordöstlichen (oberen linken) Ecke des Maṇḍala des Schoßreichs (Garbhadhātu) dargestellt, einem der beiden Haupt-Maṇḍalas des ostasiatischen esoterischen Buddhismus.
Yijing beschreibt die Statuen des Mahākāla, die er in indischen Klöstern gesehen hatte, als "einen goldenen Beutel haltend und auf einem kleinen Stuhl sitzend, mit einem Fuß zum Boden hängend." Einige Gelehrte glauben, dass es sich bei den Bildern, die Yijing sah, tatsächlich um die des Gottes Kubera gehandelt haben könnte, der in der indischen Kunst als Träger eines Geldbeutels dargestellt wurde; tatsächlich identifiziert er "Mahākāla" als Teil des Gefolges des "großen Gottes" (大天, d.h. Mahādeva / Maheśvara). Es wird vermutet, dass die beiden Götter irgendwann miteinander verschmolzen wurden; Bilder beider Gottheiten finden sich häufig an den Eingängen von Tempeln in Indien, Nepal und anderen Orten, die von der hinduistisch-buddhistischen Kultur beeinflusst sind, und Kubera war, wie erwähnt, eng mit Shiva verbunden. Es wird angenommen, dass das Bild des sacktragenden Daikokuten, das in Japan zum Standard wurde, aus der Ikonographie von Kubera stammt.
Die frühesten japanischen Darstellungen des Mahākāla-Daikokuten lassen sich in zwei Typen einteilen:
- Die eine (mit der Shingon-Schule assoziiert) zeigt die Gottheit stehend, in der linken Hand einen über die Schulter geschlungenen Sack haltend, die rechte Hand zur Faust geballt und auf der rechten Hüfte ruhend,
- während die andere (mit der Tendai-Schule assoziiert) ihn sitzend darstellt.
Die meisten dieser Bilder zeigen den Daikokuten in japanischer Kleidung, einige wenige zeigen ihn in einer Rüstung. Die stehende Darstellung wird erstmals im Shingon-Werk Yōson dōjōkan (要尊道場観, "Visualisierungen der rituellen Sphären der wesentlichen Gottheiten") aus dem 10. Jahrhundert und in einem apokryphen Text aus dem 11. Jahrhundert mit dem Titel Daikokutenjin-hō (大黒天神法, Das Tantra des Mahākāla"), während die sitzende Darstellung zum ersten Mal im 13. Jahrhundert im Asabashō (阿娑縛抄), einem ikonographischen und rituellen Kompendium der Tendai, literarisch erwähnt wird.
Im Daikokutenjin-hō wird der Daikokuten als schwarzer Mann beschrieben, der eboshi (烏帽子, eine schwarze Mütze, die von japanischen Adligen getragen wird), kariginu (狩衣, informelle aristokratische Oberbekleidung) und hakama (lockere, rockähnliche Hose) trägt, wobei seine rechte Faust auf seiner Taille ruht und seine linke Hand eine große Tasche umklammert, deren Farbe die von Rattenhaaren ist.
Die ältesten erhaltenen Beispiele der beiden ikonografischen Varianten stammen aus dem 11. Jahrhundert (späte Heian-Zeit). Die älteste stehende Daikokuten-Statue befindet sich im Kanzeon-ji in Dazaifu, Präfektur Fukuoka, und zeigt ihn in Eboshi, knielangem Hakama und Schuhen. Die älteste Darstellung des sitzenden Daikokuten, die im Kongōrin-ji im Bezirk Echi in der Präfektur Shiga aufbewahrt wird, zeigt ihn in einer Rüstung, auf einem Felsen sitzend und in der Hand eine kleine Tasche und eine Keule oder einen Stab.
Die Ikonografie des Daikokuten entwickelte sich ab dem 14. Jahrhundert, als er zunehmend als lächelnder Mann mit rundem Bauch dargestellt wurde, der einen Hammer hält und auf Reisballen steht oder sitzt. Der Ursprung des Hammerattributs ist ungewiss, obwohl Bernard Faure (2015) es mit Mahākāla-Daikokutens Verbindung zum Kult der Saptamātṛkas (der "Sieben Mütter") in Verbindung bringt, die im Madarijin (摩怛哩神)-Ritual mit einem Hammer in der Hand dargestellt werden, der ihre Rolle als Pestgöttin symbolisiert. Im 16. Jahrhundert (späte Muromachi-Periode) wurden die drei Gottheiten Daikokuten, Vaiśravaṇa-Bishamonten und Sarasvatī-Benzaiten zum dreiköpfigen "Sanmen Daikokuten" (三面大黒天, wörtlich: "Dreigesichtiger Daikokuten") verschmolzen, was in gewisser Weise die populäre gütige Form der Gottheit mit ihrer weniger bekannten zornigen Form "wieder verband". Diese Form wurde schließlich in späteren Varianten der Legende von Daikokutens Erscheinung vor Saichō auf dem Berg Hiei eingeführt: Als Antwort auf Saichōs Dilemma, wie er den täglichen Lebensunterhalt für dreitausend Mönche bestreiten sollte, soll der Gott sich ihm nun mit drei Gesichtern und sechs Armen gezeigt haben.
Im gleichen Zeitraum entwickelte sich auch eine ikonografische Gruppierung, die als "Roku Daikoku" (六大黒天, wörtlich "Sechs Daikoku") bekannt ist und die Gottheit in sechs verschiedenen Formen zeigt:
- Biku Daikoku (比丘大黒): Daikokuten in Form eines buddhistischen Mönchs (bhikkhu), der in der rechten Hand einen Hammer und in der linken Hand ein Schwert hält
- Ōji Kara Daikoku (王子迦羅大黒): Daikokuten als Prinz (王子, ōji), der ein Schwert und einen Vajra schwingt; wird manchmal als Mahākāla-Daikokutens Sohn interpretiert
- Yasha Daikoku (夜叉大黒): Daikokuten als Bezwinger von Dämonen (yakṣa), in japanischer Adelskleidung und mit einem Rad (dharmacakra) in der rechten Hand
- Makakara Daikokunyo (摩伽迦羅大黒女): Daikokuten als weibliche Figur, die einen Reisballen über dem Kopf hält; manchmal als Mahākāla-Daikokutens Gemahlin (d.h. Mahākāḷī) interpretiert
- Shinda Daikoku (信陀大黒 oder 真陀大黒): Daikokuten als Junge mit dem wunscherfüllenden Juwel (cintāmaṇi) in der Hand
- Makara Daikoku (摩伽羅大黒): Daikokuten in seiner "normalen", gutmütigen Gestalt, einen Hammer und einen Sack haltend
Im 17. und 18. Jahrhundert (Edo-Zeit) entstand der Kult der Sieben Glücksgötter (Shichifukujin), zu denen Daikokuten gehört. Die zunehmende Beliebtheit des Daikokuten beim einfachen Volk während des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit führte dazu, dass der Gott zu einem beliebten Motiv in der Kunst wurde.
Anbetung
Der Gott genießt in Japan nach wie vor eine herausragende Stellung als Glücks- und Haushaltsgottheit. Abbildungen des Daikokuten finden sich sowohl in buddhistischen Tempeln als auch in Shinto-Schreinen des Landes (ein Überbleibsel der langjährigen Verschmelzung der beiden Religionen), obwohl sie im letzteren Fall gewöhnlich als Darstellungen des japanischen Gottes Ōkuninushi und nicht des buddhistischen Mahākāla interpretiert und verehrt werden.
Aufgrund seiner Assoziation mit Ratten gelten die Tage im Tierkreiszeichen der Ratte (子日, ne-no-hi), insbesondere das der Yang-Holz-Ratte (甲子, kōshi / kinoe-ne), als heilig für Mahākāla-Daikokuten (und im weiteren Sinne, Ōkuninushi), wobei der erste (初甲子, hatsu kōshi) und der letzte kōshi-Tag (納め甲子, osame kōshi) eines Jahres besonders hoch geschätzt werden. An diesen Tagen werden an vielen der Gottheit gewidmeten Kultstätten besondere Zeremonien und Feste abgehalten
In der frühen Neuzeit führte die Assoziation von Daikokuten mit Reichtum und Wohlstand zu einem Brauch, der als fukunusubi oder "Diebstahl des Glücks" bekannt wurde. Dieser Brauch beruhte auf dem Glauben, dass demjenigen, der göttliche Figuren stahl, Glück beschieden war, wenn er nicht auf frischer Tat ertappt wurde. Der toshi-no-ichi (Jahresendmarkt) am Sensō-ji in Asakusa wurde zum Hauptschauplatz für den Verkauf und die Veräußerung solcher Bilder durch die Glückssucher. Am Vorabend des Neujahrsfestes wurden viele kleine Stände eröffnet, an denen Artikel, darunter auch Bilder von Daikokuten, verkauft wurden. Ein anderer Brauch, der als tsubute (礫, wörtlich "Steinwurf") bekannt ist, bestand darin, den Reichtum aus einem reichen Haus zu "stehlen", indem man zur Stunde der Ratte (um Mitternacht) einen Daikokuten-Talisman hineinwarf.
Ein esoterisches Ritual, das in vielen Tendai-Tempeln, in denen Daikokuten verehrt wird, durchgeführt wird, ist als yokubei-ku (浴餅供, wörtlich: "Klebereisbad") bekannt und beinhaltet das Übergießen einer Statue der Gottheit mit Reisbrei.
Bījā und Mantra
Die bīja oder Keimsilbe, die im japanischen esoterischen Buddhismus zur Darstellung von Mahākāla-Daikokuten verwendet wird, ist ma (म), geschrieben in der Siddhaṃ-Schrift. Mahākālas Mantra lautet inzwischen wie folgt:
Sanskrit
- Oṃ Mahākālāya svāhā
Japanisch (romanisiert)
- On Makakyaraya sowaka
Chinesische Schriftzeichen
- 唵 摩訶迦羅耶 娑婆訶
Hiragana
- おん まかきゃらや そわか
Tempel
Im Folgenden sind einige Beispiele für buddhistische Tempel aufgeführt, in denen der Daikokuten entweder im Mittelpunkt der Verehrung steht (honzon) oder in denen er in einer Nebenfunktion verehrt wird.
Der Daikoku-dō (大黒堂, "Halle des Daikoku") im Tempelkomplex beherbergt ein Bildnis des dreigesichtigen Sanmen Daikokuten, das Saichō zugeschrieben wird, der es angefertigt haben soll, nachdem der Gott ihm erschienen war und versprochen hatte, der Schutzpatron seiner Klostergemeinschaft zu werden.
Einer der Anwärter auf die Geburtsstätte des Mahākāla-Daikokuten-Kults in Japan. Die Gründungsgeschichte des Tempels besagt, dass er im Jahr 665 n. Chr. von dem Asketen En no Gyōja gegründet wurde, nachdem er eine Vision von Daikokuten auf einer fünffarbigen Wolke gesehen hatte.
- Daikoku-ji (Fushimi-ku, Kyoto) - Shingon (Tōji-ha)
Er soll von Kūkai, dem Begründer des Shingon-Buddhismus, errichtet worden sein. Ihm wird auch das Bildnis des Daikokuten zugeschrieben, das als Honzon des Tempels dient. Ursprünglich Chōfuku-ji (長福寺) genannt, wurde der Tempel 1615 umbenannt, nachdem Shimazu Yoshihiro ihn als "Gebetszentrum" (祈願所, kigansho) für seinen Clan, die Shimazu, und ihr Lehen, die Domäne Satsuma, bestimmt hatte, in dem religiöse Dienste in ihrem Namen durchgeführt werden.
- Myōen-ji (妙円寺) (Matsugasaki Higashimachi, Sakyō-ku, Kyoto) - Nichiren-shū
Gegründet im Jahr 1616; auch bekannt als Matsugasaki Daikokuten (松ヶ崎大黒天). Hier steht eine Statue des Daikokuten, die Saichō zugeschrieben wird.
- Mano-dera / Mano-ji (真野寺) (Kubo, Minamibōsō, Präfektur Chiba) - Shingon (Chisan-ha)
Dieser von Gyōki im Jahr 725 n. Chr. gegründete Tempel, der dem Tausendarmigen Avalokiteśvara (Senju Kannon) gewidmet ist, beherbergt ein Abbild des Daikokuten, von dem behauptet wird, es sei das Werk des Tendai-Priesters Ennin, bekannt als "Asahi Kaiun Daikokuten" (朝日開運大黒天) - so genannt, weil Ennin es im Jahr 860 geschnitzt haben soll, nachdem er eine Vision des Gottes bei Tagesanbruch, als die Sonne aufging, gesehen hatte.
- Eishin-ji (英信寺) (Shitaya, Taitō City, Tokyo) - Jōdo-shū
Ein 1631 gegründeter Tempel für den Buddha Amitabha (Amida Nyorai). Eine dem Kūkai zugeschriebene Statue des Sanmen Daikokuten befindet sich im Daikoku-dō neben der Haupthalle des Tempels.
- Gokoku-in (護国院) (Taitō-Stadt, Tokio) - Tendai
Teil des Ueno Park-Kan'ei-ji-Tempelkomplexes. Hier wird ein Gemälde des Daikokuten aufbewahrt, das Fujiwara no Nobuzane zugeschrieben wird und dem Tempel von Tokugawa Iemitsu geschenkt wurde.
- Kyōō-ji (経王寺) (Haramachi, Shinjuku City, Tokyo) - Nichiren-shū
Gegründet 1598 durch den Mönch Nichijō, der dort ein Bildnis des Daikokuten aus dem Kuon-ji aufstellte, das angeblich von Nichirens Schüler Nippō geschnitzt wurde.
- Daihō-ji (大法寺) (Moto-Azabu, Minato City, Tokyo) - Nichiren-shū
Gegründet im Jahr 1597. Das in diesem Tempel aufbewahrte Bildnis des Daikokuten, bekannt als "Sanshin Gusoku Daikoku-sonten" (三神具足大黒尊天), zeigt die Gottheit mit den Attributen Benzaiten (Frisur) und Bishamonten (Rüstung).
- Hōju-ji (宝珠寺) - (Onogawamachi, Stadt Yonezawa, Präfektur Yamagata) - Shingon (Daigo-ha)
Im Volksmund bekannt als Kinoe-ne Daikokuten Honzan (甲子大黒天本山). Das Bildnis des Daikokuten in diesem Tempel wird Kūkai zugeschrieben und stammte ursprünglich aus dem Dainichi-ji (大日寺, im heutigen Nishikawa, Bezirk Nishimurayama), einem der vier bettō-ji (Verwaltungstempel) des Berges Yudono, einem der drei heiligen Berge der Provinz Dewa (Dewa Sanzan). Die Statue wurde an ihren heutigen Standort gebracht, nachdem der Dainichi-ji während der Meiji-Zeit in einen Shinto-Schrein umgewandelt worden war.
In der Volkskultur
Eine Theorie besagt, dass der Begriff daikoku-bashira (大黒柱), der sich auf den zentralen Stützpfeiler eines traditionellen japanischen Hauses bezieht, auf den Namen Daikokuten zurückgeht. Dieses Wort bezeichnet auch im übertragenen Sinne den Haupternährer einer Familie. Die Frau eines buddhistischen Mönchs wurde in der Umgangssprache ebenfalls als Daikoku bezeichnet, da Daikokuten mit der Küche und dem Haushalt im Allgemeinen in Verbindung gebracht wurde.
Eine im Mittelalter und in der frühen Neuzeit weit verbreitete traditionelle Kunst namens Daikoku-mai (大黒舞, wörtlich "Tanz des Daikoku") bestand darin, dass Darsteller - in der Regel sozial Ausgestoßene (hinin) - als Daikokuten verkleidet von Tür zu Tür gingen, um im Austausch gegen Spenden zu tanzen und zu singen.
Mehr erfahren
Enzyklopädie
Subscribe
Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an und verpassen Sie keine Neuigkeiten und Angebote mehr! Registrieren Sie sich einfach und unkompliziert auf unserer Website und seien Sie immer up-to-date. Jetzt anmelden!